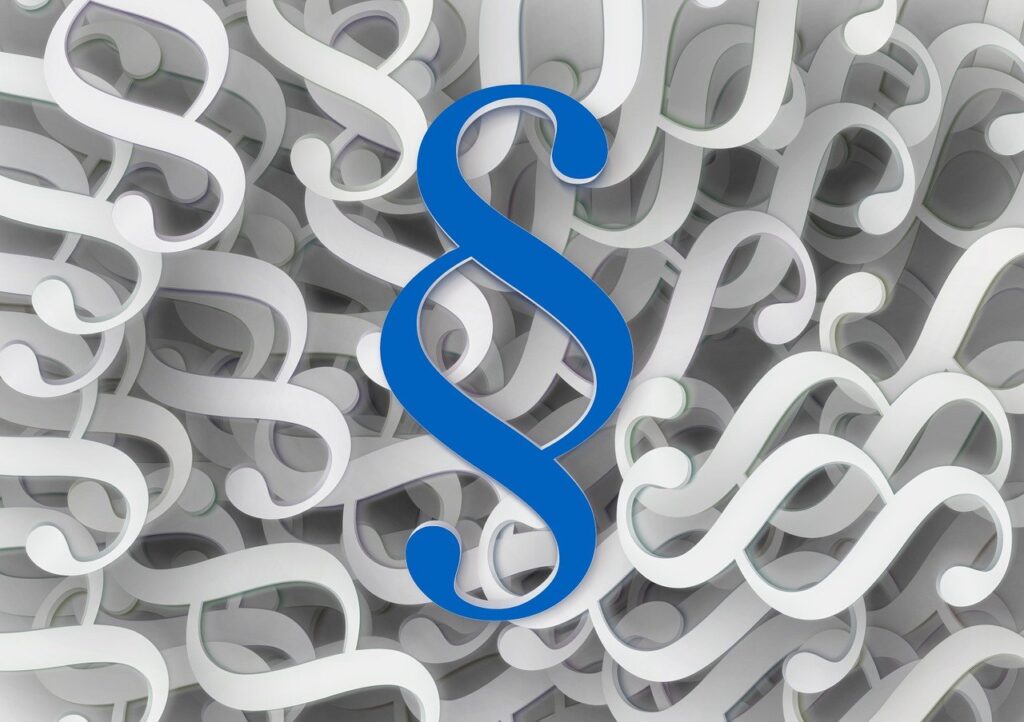
Vermögensdelikte
Die Verhinderung „sonstiger strafbarer Handlungen“ gehört zur ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation eines Instituts.
Sie muss ebenso wie die Geldwäscheprävention und die Verhinderung der Finanzierung des Terrorismus Bestandteil eines angemessenen, internen Risikomanagements sein (vgl. BT-Drucksache 17/3023, S. 60).
Basis hierfür ist eine Gefährdungsanalyse, in der die möglichen Vermögensgefährdungen des jeweiligen Instituts, die als wesentlich anzusehen sind, erfasst und bewertet werden.
Tatbestandliche Voraussetzungen
„Sonstige strafbare Handlungen“ gemäß § 25h Abs. 1 KWG
Der Begriff ist vom Gesetzgeber bewusst nicht abschließend definiert. Nach Sinn und Zweck der Vorschrift umfasst dieser Begriff alle vorsätzlich begangenen strafbaren Handlungen im Inland oder in einem anderen Rechtskreis, in dem das Kreditinstitut durch Tochtergesellschaften, Filialen oder Niederlassungen vertreten ist oder in sonstiger Weise seine Dienstleistungen aktiv erbringt, die zu einer wesentlichen Gefährdung des Vermögens des Instituts führen können.
Hierzu sind beispielhaft die nachfolgenden Fallkonstellationen zu zählen:
- Strafbare Handlung „von außen“. Umfasst sind Gefährdungen des Vermögens des Instituts aufgrund von strafbaren Handlungen eines Dritten (Kunde, Nicht-Kunde).
- Strafbare Handlung „von innen“. Umfasst sind Gefährdungen des Vermögens des Instituts, wenn mindestens eine interne Partei beteiligt ist (Mitarbeiter oder Mitglieder der Organe des Instituts als Täter).
Zu den sonstigen strafbaren Handlungen im Sinne des § 25h Abs. 1 KWG gehören unter anderem
- das Gesamtsystem der Betrugs- und Untreuetatbestände nach §§ 263 ff. StGB als Zentraldelikte, wobei nicht Voraussetzung ist, dass diese nur das Vermögen als Individualrechtsgut schützen (vgl. § 265 StGB)
- Diebstahl (§§ 242 ff. StGB), Unterschlagung (§ 246 StGB), Raub und räuberische Erpressung (§§ 249 ff. StGB)
- sonstige Delikte des Wirtschaftsstrafrechts, die Allgemeininteressen in Wirtschaft und Verwaltung schützen (wie die Funktionsfähigkeit des bargeldlosen Zahlungsverkehrs (§ 266b StGB) oder den Schutz des Vertrauens der Allgemeinheit in den Kapitalmarkt (§ 264a StGB))
- Korruption (§§ 331 ff. StGB – Vorteilsannahme, Bestechlichkeit) sowie Insolvenzstraftaten (§§ 283 ff. StGB), Steuerstraftaten (§§ 369 ff. AO) sowie Begünstigung (§ 257 StGB) und Straftaten gegen den Wettbewerb (§§ 298 ff. StGB)
- Ausspähen und Abfangen von Daten, Identitätsdiebstahl, etc. (§§ 202a ff. StGB)
Nicht umfasst sind dagegen – allerdings nur zur Vermeidung von Abgrenzungsschwierigkeiten – folgende Handlungen: Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie Insiderhandel und Marktmanipulation.
Für die Erkennung von Insiderhandel und Marktmanipulation sind im Institut andere Stellen unter Beachtung der insoweit einschlägigen Regelungen zuständig. Diese sind qualitativ einem anderen Risikomanagement unterworfen.
Vermögensgefährdung
Für § 25h Abs. 1 KWG sind die unter a) genannten sonstigen strafbaren Handlungen einschlägig, wenn sie zu einer wesentlichen Vermögensgefährdung des Instituts führen können. Der weite aufsichtsrechtliche Begriff der Vermögensgefährdung stimmt nicht mit dem von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu § 263 StGB entwickelten, gleich lautenden Begriff aus der Betrugsdogmatik überein.
Die Vermögensgefährdung nach § 25h Abs. 1 KWG stellt – anders als bei § 263 StGB – nicht zwingend eine dem Vermögensschaden gleichstehende Gefährdung dar. § 25h Abs. 1 KWG umfasst somit nicht nur operationelle Verlustereignisse im Sinne des MaRisk-Rundschreibens, die sich unmittelbar auf die Ertrags- und Vermögenslage eines Instituts auswirken. Auch Reputationsschäden können hierzu gehören, wenn sie zu einer wesentlichen Vermögensgefährdung führen können.
Angemessene Sicherungsmaßnahmen gegen sonstige strafbare Handlungen
Die für die „sonstigen strafbaren Handlungen“ relevanten Deliktshandlungen sind jedoch in weiten Bereichen mit denen im Vortatenkatalog des § 261 StGB a.F. deckungsgleich.
Diese Vortaten bestimmen damit bereits die Art und den Umfang der Sicherungsmaßnahmen nach § 6 GwG oder § 25h KWG. Dies bedeutet wiederum, dass die zur Verhinderung von Geldwäsche im Institut benutzten Sicherungsmaßnahmen und Prozesse auch zur Verhinderung von sonstigen strafbaren Handlungen im Sinne von § 25h Abs. 1 KWG genutzt werden können.
§ 261 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 StGB a.F.
- Verbrechen (allgemein, keine Einzelnorm)
§ 261 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 StGB a.F.
a)
- § 108e StGB (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern)
- § 332 Abs. 1 und 3 StGB (Bestechlichkeit)
- § 334 StGB (Bestechung)
- § 335a StGB (besonders schwere Fälle der Bestechung/Bestechlichkeit – i.V.m. §§ 332, 334)
b)
- § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BtMG (unerlaubter Umgang mit Betäubungsmitteln)
- § 19 Abs. 1 Nr. 1 GÜG (unerlaubte Handlungen mit Grundstoffen)
§ 261 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 StGB a.F.
- § 373 AO (gewerbsmäßige, bandenmäßige Steuerhehlerei)
- § 374 Abs. 2 AO (Steuerhehlerei – besonders schwere Fälle)
- § 12 Abs. 1 Marktorganisations-Durchführungsgesetz (Einbeziehung in Abgabenordnung)
§ 261 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 StGB a.F.
a)
- § 152a StGB (Fälschung technischer Aufzeichnungen)
- § 181a StGB (Zuhälterei)
- § 232 Abs. 1–3 Satz 1 und Abs. 4 StGB (Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung)
- § 232a Abs. 1 und 2 StGB (Zwangsprostitution)
- § 232b Abs. 1 und 2 StGB (Ausbeutung von Prostituierten)
- § 233 Abs. 1–3 StGB (Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung)
- § 233a Abs. 1 und 2 StGB (Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung)
- § 242 StGB (Diebstahl)
- § 246 StGB (Unterschlagung)
- § 253 StGB (Erpressung)
- § 259 StGB (Hehlerei)
- § 263 StGB (Betrug)
- § 264 StGB (Subventionsbetrug)
- § 265c StGB (Sportwettbetrug)
- § 266 StGB (Untreue)
- § 267 StGB (Urkundenfälschung)
- § 269 StGB (Fälschung beweiserheblicher Daten)
- § 271 StGB (mittelbare Falschbeurkundung)
- § 284 StGB (unerlaubtes Glücksspiel)
- § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr)
- § 326 Abs. 1, 2 und 4 StGB (umweltgefährdende Abfallbeseitigung)
- § 328 Abs. 1, 2 und 4 StGB (verbotener Umgang mit radioaktiven Stoffen und anderen gefährlichen Stoffen)
- § 348 StGB (Falschbeurkundung im Amt)
b)
- § 96 AufenthG (Einschleusen von Ausländern)
- § 84 AsylG (unerlaubte Beschäftigung von Asylbewerbern)
- § 370 AO (Steuerhinterziehung)
- § 119 Abs. 1–4 WpHG (Insiderhandel, Marktmanipulation etc.)
- §§ 143, 143a, 144 MarkenG (Markenverletzungen)
- §§ 106–108b UrhG (Urheberrechtsverletzungen)
- § 25 GebrMG (Verletzung von Gebrauchsmustern)
- §§ 51, 65 DesignG (Designschutzverletzungen)
- § 142 PatG (Patentverletzungen)
- § 10 HalblSchG (Schutz von Halbleitern)
- § 39 SortSchG (Sortenschutzverletzungen)
Hinweis: Diese Vergehen müssen gewerbsmäßig oder bandenmäßig begangen worden sein.
§ 261 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 StGB a.F.
- § 89a StGB (Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat)
- § 89c StGB (Terrorismusfinanzierung)
- § 129 StGB (Bildung krimineller Vereinigungen)
- § 129a Abs. 3 und 5 StGB (terroristische Vereinigungen)
- § 129b Abs. 1 StGB (ausländische terroristische Vereinigungen)
Hinweis: Einschließlich Vergehen durch Mitglieder solcher Vereinigungen.
§ 261 Abs. 1 Satz 3 StGB a.F.
- Ergänzung zu § 370 AO: Erfasst auch ersparte Aufwendungen, unrechtmäßige Steuererstattungen/-vergütungen
- Gegenstände, auf die sich hinterzogene Abgaben beziehen (bei Nr. 3)
§ 261 Abs. 2 StGB a.F.
- kein neuer Paragraph, sondern Tatmodalitäten:
- Verschaffen
- Verwahren
- Verwenden (bei Kenntnis der Herkunft)
Quellen:
https://www.buzer.de/gesetz/6165/al143944-0.htm
BaFin-Rundschreiben 06/2024 (BA) – Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)